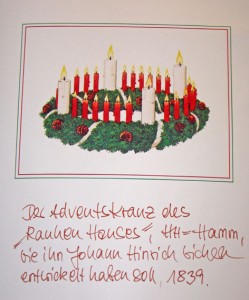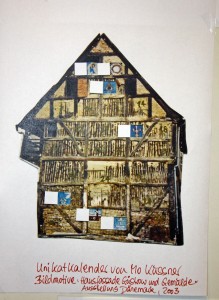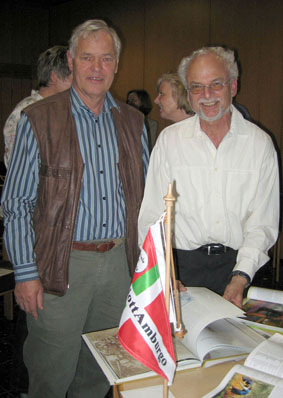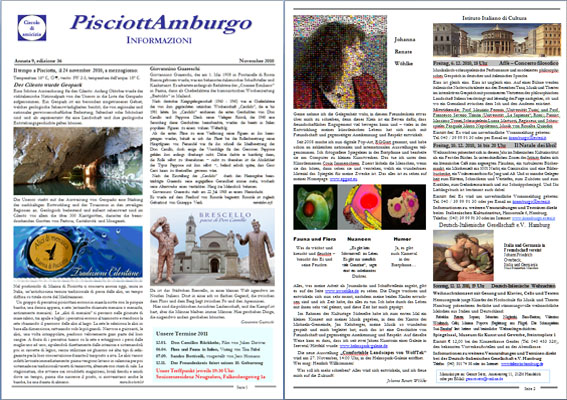erschienen im Hamburger Abendblatt am 27. November 2010
Von Johanna R. Wöhlke
24 Türchen lang Vorfreude aufs Fest
Kulturhistorikerin erklärt die Geschichte des Adventskalenders
In vielen Haushalten hängt er und hilft, das Warten auf Weihnachten zu verkürzen – der Adventskalender. Aber woher stammt diese Tradition eigentlich? Im Gesprächskreis für Frauen der Michaelisgemeinde Neugraben hatte sich die Organisatorin Renate Gresens die Kulturgeschichte des Adventskalenders vorgenommen. Dazu hielt die Hamburger Kulturhistorikerin Dr. Cornelia Göksu einen Vortrag.
Der traditionelle Kalender aus Karton behauptet sich
Cornelia Göksu: „Heute ist das Angebot kaum noch überschaubar. Es gibt Adventskalender aller Art: fromme und frivole, für Kinder und Erwachsene, mit Bierdosen, mit Leckereien für den Hund, mit CDs, im Internet und mit technischem Schnickschack.
Dennoch behauptet sich der traditionelle Adventskalender aus Karton, der schön gestaltet ist und nicht mehr als 24 Türchen zu bieten hat, noch immer bestens. Vielleicht, weil man dabei nicht so sehr vom Ziel abgelenkt wird – und das ist immer noch Weihnachten.
Andererseits rücken nicht-kommerzielle Adventskalender, wie „DER ANDERE ADVENT“ wieder die besinnliche religiös-philosophisch-christliche Seite von Weihnachten ins Zentrum.“
Und wie waren die Anfänge? Geht man weit in der Entwicklung zurück, erscheinen die unruhevollen Mittwinternächte, erfüllt mit vielen skurrilen Gestalten und sie begleitenden Bräuchen, die von der Kirche nach und nach ins Positive entdämonisiert und umgedeutet wurden in eine klare Zeit der Erwartung, der Vorbereitung auf „die Ankunft des göttlichen Lichtes“. Dieser christliche Sinn der vier Adventswochen vor Weihnachten wurde bereits auf der Kirchenversammlung von Aachen im Jahre 826 eingeführt.
In seiner weiteren Entwicklung lässt sich der Adventskalender auch als Zählhilfe und religiöse Adventspädagogik einstufen. Denn als sein Vorläufer wird zum Beispiel das „Kerbholz“ angesehen, das Kinder spielerisch in der Zeit vor dem ersehnten Gabenfest dazu nutzten, ihre guten Taten, zum Beispiel Gebete, Hilfe in Landwirtschaft und Haushalt, gute Noten, gutes Betragen und ähnliches dort mit einer Kerbe zu kontieren - Zählkulte aus dem protestantisch-lutherischen Umfeld.
Der weltweit erste Adventskalender wurde allerdings erst vor 100 Jahren von der Hamburger Evangelischen Verlagsbuchhandlung Trümpler gedruckt. Sie brachte im Spätherbst 1902 einen Adventskalender auf den Markt, der dem Zifferblatt einer Uhr entlehnt war, deckte allerdings nur die Hälfe der Zeit, nämlich vom 13. bis 24. Dezember ab, ein Adventskalender als eine Art „Weihnachtsuhr“.
Eine frühe „Weihnachtsuhr“, so Cornelia Göksu, stellt auch der Adventskranz dar. Der Gründer des „Rauhen Hauses“ und der „Inneren Mission“ in Hamburg, Johann Hinrich Wichern, gilt als sein Erfinder. Dort wurde auf dem Tannenkranz, der sich auf dem großen Kronleuchter befand, täglich zur Adventsandacht ein Licht angesteckt, vier große und 24 kleine. Später, als Wichern in Berlin Tegel das Waisenhaus leitete, wurde der Kronleuchter bald durch einen Tannenkranz ersetzt und trat von dort aus als Adventskranz nach dem 1. Weltkrieg seinen Siegeszug von Norden nach Süden an.
1908 erschien in Schwaben der erste Kalender als Bastelbogen
Der erste Adventskalender, der die gesamte Adventszeit umfasste, erschien 1908 aufgrund einer Idee des schwäbischen Pastorensohnes Gerhard Lang. Dieser „Münchner Weihnachtskalender“ erschien unter dem Titel „Im Lande des Christkinds“. Es war ein farbiger Bastelbogen, aus dem die Kinder jeden Tag eines von 24 Bildern ausschneiden sollten. Kalender mit Türchen kamen Anfang der zwanziger Jahre auf den Markt. Zuerst verbargen sich hinter den Türchen Bibelverse und Liedtexte, dann auch Bilder von Weihnachtsmännern, Engeln und Märchenfiguren.
Cornelia Göksu: „ Weniger fromm aber schmackhaft war der Kalender, den die Dresdner Firma PEA C.C. 1938 auf den Markt brachte. Erstmals konnte man den geöffneten Türen Schokolade entnehmen. Dieser Siegeszug für die Süßwarenindustrie wurde allerdings erst einmal durch den 2. Weltkrieg gestoppt.
Allerdings ging es schon 1946 weiter und zwar mit einem Kalender des Richard Sellmer Verlages in Stuttgart, der heute noch im Geschäft ist.“
Erstaunt waren die Zuhörerinnen in Neugraben, dass der Adventskalender inzwischen auch ein Exportschlager in viele europäische Staaten ist, nach Amerika, Japan oder die Vereinigten Arabischen Emirate.